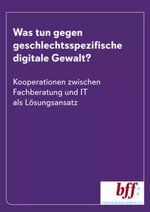StoP - Stadtteile ohne Partnergewalt
Das Projekt StoP - Stadtteile ohne Partnergewalt - hat sich zum Ziel gesetzt, Gewaltbetroffene und soziale Netzwerke in Stadtteilen so zu stärken, dass Partnergewalt nicht mehr erduldet, verschwiegen, ignoriert oder toleriert wird. StoP arbeitet systematisch auf zwei Ziele hin: Die Veröffentlichungsbereitschaft Gewaltbetroffener und Gewaltausübender wird aufgebaut. Die Interventionsbereitschaft und die Zivilcourage eines lokalen Gemeinwesens wird auf- bzw. ausgebaut. Langfristiges Ziel von StoP ist es, dass die Entstehung von Täterschaft verhindert wird und die Zahl der Gewalthandlungen im häuslichen Bereich sinkt. Das Handlungskonzept wird in acht Umsetzungsschritten im Stadtteil verwirklicht. StoP-Projekte gibt es unter anderem in Berlin, Dresden, Hamburg, Braunschweig und Oldenburg. https://stop-partnergewalt.org/
Bei häuslicher Gewalt oder sexuellen Übergriffen besteht für die Betroffenen eine hohe Hemmschwelle, ihre Rechte wahrzunehmen und direkt bei der Polizei eine Anzeige zu erstatten. Viele Gewaltopfer können sich erst mit zeitlichem Abstand zur Tat durchringen, Strafanzeige zu stellen. Etwaige Spuren oder Befunde, die für die strafrechtlichen Ermittlungen von Relevanz sind, können dann oft nicht mehr gesichert und dokumentiert werden. Seit 2012 bietet daher das an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) verankerte Netzwerk ProBeweis Betroffenen von häuslicher oder sexueller Gewalt eine verfahrensunabhängige und vertrauliche Spurensicherung an. Mittlerweile verfügt Niedersachsen mit 45 Untersuchungsstellen an 39 Partnerkliniken über ein flächendeckendes Beweissicherungsangebot für Gewaltopfer.
Niedersachsen hat als erstes Bundesland die Finanzierung dieser rechtsmedizinischen Leistungen mit den Gesetzlichen Krankenkassen geregelt und in einen Vertrag überführt. Damit wird die forensische Spurensicherung durch das Netzwerk ProBeweis ab 1. Januar 2024 eine kassenfinanzierte Leistung nach Sozialgesetzbuch V. Zudem wird die landesseitige finanzielle Unterstützung vom Netzwerk ProBeweis ebenfalls ab 1. Januar 2024 deutlich verbessert.
Die Vertragsvereinbarung zwischen den GKV, der MHH/Netzwerk ProBeweis und dem Land Niedersachsen sieht vor, dass pro behandeltem Fall beziehungsweise erfolgter Spurensicherung 421 Euro netto pauschal an das Netzwerk ProBeweis erstattet werden. Hiervon wird das Netzwerk 200 Euro netto an die jeweilige leistungserbringende Klinik aus dem Netzwerk überweisen. Bisher konnte das Netzwerk ProBeweis aus den Mitteln des Gesundheitsministeriums lediglich eine Fallpauschale von 50 Euro netto an die Kliniken auszahlen.
Für die gerichtsverwertbare Dokumentation werden die Betroffenen körperlich untersucht, nötigenfalls werden Proben entnommen. Verletzungen werden fotografiert. Alle Befunde werden manipulations- und zugriffssicher aufbewahrt und können im Falle einer Anzeige und Schweigepflichtsentbindung abgefordert und in ein Strafverfahren eingebracht werden.
Weitere Informationen und Kontakt: www.probeweis.de
Die Zahl der Opfer von Häuslicher Gewalt lag im Jahr 2022 bei 240.547 Opfern und ist damit um 8,5 Prozent im Vergleich zum Jahr 2021 gestiegen. Das zeigt das neue umfassende Lagebild, das von Bundesinnenministerin Nancy Faeser, Bundesfrauenministerin Lisa Paus und dem Präsidenten des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, in Berlin vorgestellt wurde.
Das neue Lagebild Häusliche Gewalt ist eine Fortschreibung und Ergänzung der früheren Kriminalstatistischen Auswertung Partnerschaftsgewalt, die seit 2015 jährlich durch das Bundeskriminalamt (BKA) veröffentlicht wurde. Neben der Partnerschaftsgewalt werden nun auch die Delikte der sog. innerfamiliären Gewalt von und gegen Eltern, Kinder, Geschwister und sonstige Angehörige mitbetrachtet, so dass es nun eine bundesweite Lageübersicht zur Häuslichen Gewalt insgesamt gibt.
Im Bereich der Partnerschaftsgewalt stieg die Anzahl der Opfer um 9,1 Prozent auf 157.818 Opfer. Ganz überwiegend trifft Gewalt im häuslichen Kontext Frauen: 80,1 Prozent der Opfer von Partnerschaftsgewalt und 71,1 Prozent der Opfer Häuslicher Gewalt insgesamt sind weiblich. Von den Tatverdächtigen bei Partnerschaftsgewalt sind 78,3 Prozent Männer, im Gesamtbereich der Häuslichen Gewalt 76,3 Prozent.
Im Bereich der Partnerschaftsgewalt lebte die Hälfte der Opfer mit der tatverdächtigen Person zusammen. Die Mehrheit sowohl der Opfer als auch der Tatverdächtigten waren zwischen 30 und 40 Jahre alt, im Bereich der Innerfamiliären Gewalt waren unter 21-Jährige Opfer am häufigsten betroffen. 133 Frauen und 19 Männer sind im Jahr 2022 durch ihre Partner oder Ex-Partner getötet worden.
Opfer von Häuslicher Gewalt insgesamt wurden im Jahr 2022 (jeweils vollendete und versuchte Delikte):
- Opfer von Tötungsdelikten: 702 Opfer (248 männlich und 454 weiblich), davon 239 Opfer von vollendeten Tötungsdelikten (58 männlich und 181 weiblich) und 463 Opfer von versuchten Tötungsdelikten (190 männlich, 273 weiblich)
- Opfer von vorsätzlicher einfacher Körperverletzung: 135.502 Opfer (39.766 männlich und 95.736 weiblich)
- Opfer von Bedrohung, Stalking und Nötigung: 57.376 Opfer (13.332 männlich und 44.044 weiblich)
- Opfer von Freiheitsberaubung: 2.575 Opfer (437 männlich und 2.138 weiblich)
- Opfer von gefährlicher Körperverletzung: 28.589 Opfer (11.277 männlich und 17.312 weiblich)
Die Zahlen von polizeilich registrierter Häuslicher Gewalt steigen nahezu kontinuierlich an, in den letzten fünf Jahren um 13 Prozent. Doch viele Taten werden der Polizei nicht gemeldet, etwa aus Angst oder Scham.
Start umfassender Dunkelfeldstudie
Wie groß dieses Dunkelfeld ist, soll die Studie „Lebenssituation, Sicherheit und Belastung im Alltag“ (LeSuBiA) herausfinden. Die großangelegte Untersuchung wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, dem Bundesministerium des Innern und für Heimat sowie dem Bundeskriminalamt verantwortet. Deutschlandweit sollen 22.000 Menschen befragt werden. Erste Ergebnisse werden 2025 vorliegen.
Die Teilnehmenden an der Studie werden zufällig aus den Einwohnermelderegistern ausgewählt. Befragt werden sie zur aktuellen Lebenssituation, zu Sicherheit und zu Belastungen im Alltag. Ein Schwerpunkt liegt auf der Erhebung von Gewalterfahrungen in Paarbeziehungen sowie Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt und digitaler Gewalt. Zudem enthält die Studie Fragen zu Erfahrungen mit Polizei, Medizin, Gerichten und Opferhilfeeinrichtungen.
Zwanzig Jahre nach der letzten Opferbefragung des BMFSFJ liefert die Studie nicht nur aktuelle, repräsentative, bundesweite Daten zur Gewaltbelastung von Frauen, sondern erstmals auch von Männern. Mit der Durchführung von Zusatzstichproben werden zudem repräsentative Aussagen zur Gewaltbelastung in Partnerschaften, sexualisierter und digitaler Gewalt von Menschen mit Migrationshintergrund ermöglicht.
Die Studie ist angesichts ihres Umfangs, der anspruchsvollen Methode sowie des geschlechtsübergreifenden Ansatzes in Deutschland bislang einmalig. Die Ergebnisse sollen dazu beitragen, effiziente und wirksame politische Strategien zu entwickeln und die erforderlichen Gewaltschutzmaßnahmen passgenauer zu gestalten.
Für die wissenschaftliche Begleitung des Projekts wurde ein Forschungsbeirat einberufen, dem zehn Expertinnen und Experten aus den Bereichen Gewalt-, Gender- und Umfrageforschung sowie Opferhilfe und Medizin angehören.
Das Lagebild Häusliche Gewalt zum Berichtjahr 2022 finden Sie hier: www.bmi.bund.de/20336752
Weitere Informationen zur Studie unter: www.bka.de/lesubia
Quelle: Pressemitteilung des BMFSFJ vom 11.7.2023